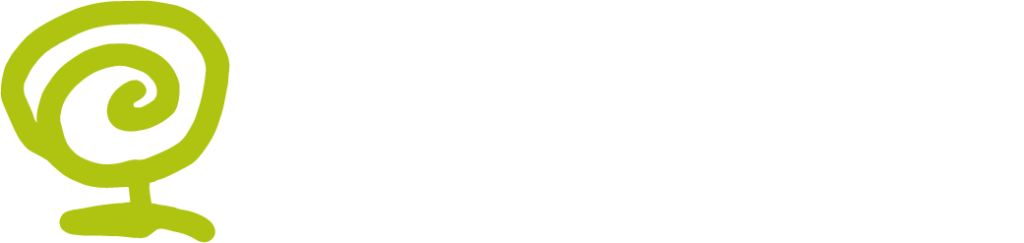Mode im Überfluss: Warum unser Konsumverhalten zum Klimaproblem wird
Modisch, billig, jederzeit verfügbar – das ist das Versprechen von Fast Fashion. Was einst exklusiv war, ist heute ein Massenprodukt geworden. Doch was viele nicht wissen: Hinter der hübschen Fassade verbirgt sich ein beispielloses Umwelt- und Sozialproblem. Fast Fashion heizt nicht nur die Kauflaune an, sondern auch unser Klima – wortwörtlich.
Allein in Deutschland kauft jeder Verbraucherin im Schnitt 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr. Das wäre nicht weiter problematisch, würden wir sie auch lange tragen. Doch genau das Gegenteil ist der Fall: Die Nutzungsdauer unserer Kleidung hat sich in den letzten 15 Jahren halbiert. Wir kaufen mehr, tragen weniger, werfen schneller weg – und übersehen dabei die massiven Folgen.
Fast Fashion – das Konzept hinter dem Trend
Der Begriff Fast Fashion beschreibt ein Geschäftsmodell, das darauf basiert, ständig neue Kollektionen auf den Markt zu bringen – zu extrem niedrigen Preisen. Getragen wird die Mode oft nur wenige Male, bevor sie durch den nächsten Trend ersetzt wird. Hersteller produzieren in rasender Geschwindigkeit und zu geringsten Kosten, um mit dem Tempo des Marktes mitzuhalten.
Die Kleidung ist dabei so günstig, dass Reparieren, Weitergeben oder gar Nachdenken über Nachhaltigkeit kaum eine Rolle spielt. Sie wird zu einem Wegwerfprodukt, obwohl Mode einst ein Ausdruck von Individualität und Wert war. Was als „Trendbewusstsein“ verkauft wird, ist in Wahrheit eine ökologisch und sozial hochproblematische Spirale.
Die ökologische Rechnung: CO2, Wasser und Giftstoffe
Klimakiller Kleidung
Fast Fashion ist ein Treiber der Klimakrise. Die Textilindustrie verursacht mehr als 10 % der weltweiten CO2-Emissionen, das ist mehr als die internationale Luft- und Schifffahrt zusammen auslösen. Das liegt nicht nur an den langen Transportwegen, sondern auch an den energieintensiven Produktionsprozessen, dem massiven Ressourcenverbrauch und der Tatsache, dass viele Kleidungsstücke nicht recycelt, sondern verbrannt oder deponiert werden.
Ein einzelnes T-Shirt hinterlässt einen gewaltigen Fußabdruck: rund 11 Kilogramm CO2, 2.000 Liter Wasser und diverse Chemikalien für nur ein Produkt, das oft weniger als zehnmal getragen wird.
Wasserverbrauch und Wasserverschmutzung
Kleidung ist durstig, extrem durstig. Für die Herstellung von Baumwolle, einem der Hauptbestandteile vieler Textilien, wird enorm viel Wasser benötigt. Um genau zu sein bis zu 2.000 Liter Wasser für ein einziges T-Shirt. Diese Ressourcen stammen oft aus Regionen, die ohnehin unter Wasserknappheit leiden.
Doch der Schaden geht noch weiter: Das Färben und Behandeln der Stoffe erfordert riesige Mengen an Wasser und Chemikalien. Rund 20% der globalen industriellen Wasserverschmutzung gehen laut Umweltberichten auf das Konto der Textilbranche. 60 Liter Wasser pro Kilogramm Garn werden allein fürs Färben benötigt. Oft gelangt dieses Wasser anschließend ungeklärt in Flüsse und Seen, vergiftet Ökosysteme und gefährdet die Trinkwasserversorgung.
Ein Kilogramm Kleidung = Ein Kilogramm Chemikalien
So erschreckend es klingt: Für jedes Kilogramm Kleidung kommen im Durchschnitt ebenso viele Chemikalien zum Einsatz. Viele davon sind toxisch, einige sogar krebserregend. Die Rückstände bleiben nicht nur im Wasser, sondern oft auch auf der Haut, besonders bei günstiger Kleidung, die unzureichend kontrolliert wird.
Mikroplastik: Unsichtbares Gift aus der Waschmaschine
Ein besonders problematischer Aspekt von Fast Fashion ist der Einsatz synthetischer Fasern wie Polyester, Nylon oder Acryl. Diese Fasern basieren auf Erdöl – einem nicht erneuerbaren fossilen Rohstoff und sind extrem billig in der Herstellung. Beim Waschen lösen sich winzige Fasern ab, die als Mikroplastik über das Abwasser in Flüsse, Seen und letztlich die Ozeane gelangen.
Studien belegen, dass 35 % des Mikroplastiks in den Weltmeeren auf die Textilindustrie zurückgeht. Dieses Mikroplastik wird von Meereslebewesen aufgenommen, gelangt so in die Nahrungskette und am Ende auf unsere Teller.
Textilmüllberge: 92 Millionen Tonnen jährlich
Kaum ein Produkt wird so schnell entsorgt wie Kleidung. Die Wegwerfmentalität der Fast Fashion führt dazu, dass weltweit 92 Millionen Tonnen Textilabfälle entstehen – jedes Jahr. Und das Schlimmste: Weniger als 15% davon werden recycelt. Die meisten Kleidungsstücke landen auf Mülldeponien oder werden verbrannt mit verheerenden Folgen für Luft, Boden und Klima.
Hinzu kommt das Problem der Überproduktion. Viele Kleidungsstücke bleiben unverkauft und werden systematisch vernichtet. Der Wert von Kleidung wird so buchstäblich verbrannt.
Arbeitsbedingungen: Billige Mode auf dem Rücken der Ärmsten
Fast Fashion schadet nicht nur der Umwelt, sondern auch den Menschen, die sie produzieren. Genäht wird überwiegend in Ländern wie Bangladesch, Vietnam oder Äthiopien – unter Bedingungen, die oft an moderne Sklaverei erinnern. Näherinnen arbeiten für Hungerlöhne, oft ohne Arbeitsschutz, Sozialversicherung oder gewerkschaftliche Vertretung.
Weniger als ein Prozent des Endverkaufspreises eines Kleidungsstücks landet bei den Arbeiter*innen. Sie schuften bis zu 14 Stunden täglich in stickigen, unsicheren Fabriken, mit giftigen Chemikalien und unter enormem Zeitdruck. Immer wieder kommt es zu Bränden, Gebäudeeinstürzen und gesundheitlichen Langzeitschäden, wie der tragische Einsturz des Rana-Plaza-Gebäudes 2013 auf traurige Weise zeigte.
Warum auch „natürliche“ Materialien problematisch sein können
Baumwolle, Wolle, Viskose – viele denken, diese natürlichen Fasern seien automatisch umweltfreundlich. Doch auch sie bringen Probleme mit sich. Baumwolle etwa benötigt nicht nur Wasser, sondern auch riesige Mengen an Pestiziden. In einigen Regionen sind Baumwollplantagen für den Rückgang der Biodiversität, die Austrocknung von Flüssen und gesundheitliche Probleme bei Arbeiter*innen verantwortlich.
Wolle stammt oft von Schafen, deren Haltung große Mengen Methan – ein starkes Treibhausgas – produziert. Auch hier gibt es Missstände, etwa beim Mulesing, einer qualvollen Praxis, bei der Schafen ohne Betäubung Haut entfernt wird, um Parasitenbefall zu verhindern.
Was kann ich tun? Nachhaltigkeit beginnt im Kleiderschrank
Die Herausforderungen sind groß doch jeder Einzelne kann etwas tun. Denn mit jedem Kauf treffen wir eine Entscheidung: für oder gegen Umweltverschmutzung, Ausbeutung und Ressourcenverschwendung.
Diese Schritte helfen wirklich:
Weniger, dafür bewusster kaufen: Frage dich vor jedem Kauf: Brauche ich das wirklich?
Secondhand ist Trend: In Secondhand-Läden, auf Flohmärkten oder Onlineplattformen findet man wahre Schätze.
Kleidertausch statt Neukauf: Organisiere oder besuche Kleidertausch-Partys mit Freund*innen oder in deiner Stadt.
Reparieren und pflegen: Ein Loch ist kein Grund zum Wegwerfen: Nadel, Faden oder die Änderungsschneiderei helfen weiter.
Auf Siegel achten: Zertifizierungen wie GOTS, Fair Wear oder OEKO-TEX geben Orientierung beim Kauf nachhaltiger Mode.
Kleidung ausleihen statt kaufen: Besonders für Anlässe wie Hochzeiten, Events oder Jobs lohnt sich Kleidung zum Leihen.
Fazit: Kleidung mit Köpfchen – für Mensch, Umwelt und Klima
Fast Fashion ist bequem, günstig und überall, aber sie hat ihren Preis. Und den zahlen am Ende wir alle: durch Umweltzerstörung, Klimawandel, Mikroplastik und soziale Ungerechtigkeit. Es ist höchste Zeit umzudenken. Nachhaltige Mode ist kein Verzicht, sondern eine bewusste Entscheidung für Qualität, Respekt und Verantwortung.
Mode darf Spaß machen, aber sie sollte nicht auf Kosten anderer entstehen. Denn ein schöner Look ist nur dann wirklich stilvoll, wenn er auch ethisch und ökologisch vertretbar ist.